
Vor einem Vorhang aus Ketten mit mehr oder minder prallen Romben aus schwarzem Plastik, zeigt sich ein Anzugmann in elegantem Grau, performt ohne Hast Turn- und Tanzübungen und rührt sich kaum vom Fleck. Sollte das hier jene Selbstertüchtigungsprogramme assoziieren lassen, wie sie schon lange vor dem Lockdown als Videos boomten zum Joggen und Ausdauertraining auf der Stelle? Wohl eher nicht. Vielmehr war das vielleicht eine kleine Antizipation dessen, was uns dann gleich erwarten würde. Oder war das gar schon seine spoiling Quintessenz?
Momentum Zero der Titel ja schon denkwürdig. Lateinischen Ursprungs das erste Wort, das zweite fast identisch in sechs europäischen Sprachen. Da steht dieses Zero nicht nur, aber auch für Null - und für Nichts.
In Deutschland, vor allem im Westen, wurde die Stunde Null nach 1945, vielleicht auch unter dem Eindruck des Films von Roberto Rossellini Germania anno Zero, zum Problem in der Auseinandersetzung mit der Vergangenheit, besonders mit dem Begriff der Tabula rasa in der westdeutschen Nachkriegsliteratur, wo dann Holocaust, die Ursachen des 2. WK, ja sogar der alliierte Bombenterror bestenfalls randständig Platz fanden. Man war sich noch nicht bewusst, was schon längst gedacht und formuliert war: "Das Vergangene ist nicht tot, es ist nicht einmal vergangen"(William Faulkner).
Nachdenken über den Text zum Tanzstück seiner Dramaturgin Anke Euler, der im Saal ausliegt, vielleicht auch online verfügbar sein sollte, über den einleitend kursiv gesetzten Traum, nein kein Albtraum:
In der Nacht hatte ich von den Perchten geträumt, sie haben den Winter meiner Gefühle vertrieben. Ich zeugte ein Kind mit dem Frühling, es ist vielleicht nicht hübsch, aber es sprüht vor Leben. Und dafür liebe ich es besonders, es kann die Uhr nicht lesen, es lebt nur für den Moment.
Ja, die Perchten, diese Gestalten alpenländischer Folklore, hier die Guten, die den Winter austreiben - und uns später noch einmal begegnen. Ein Frühlingskind ward geboren, "es lebt nur für diesen Moment". Ein Carpe diem, könnte man sagen, also jenes Pflücke den Tag des Horaz. Vielleicht zu viel verlangt, dass Traumbilder etwas davon mit aufnehmen.
Der 2. große Absatz des Textes beginnt mit
Momentum Zero. Der Augenblick des Nichts. Dort, wo alles beginnt. Der Zustand, als die Elemente sich neu sortierten. Der Punkt zwischen dem, was war und dem, was kommt. Der Moment, in dem du erkennst, dass sich die Welt verändert hat oder du ein/e Andere*r geworden bist.
Ein Innehalten, eine Rückbesinnung, ein fantasievolles Überpinseln der Schattenseiten. Ewiges Comeback des Vertrauten - oder die Entscheidung, ins Ungewisse zu springen.
Es beginnt die Phase der Reflexion. Positiv gesagt, wird das "Nichts" hier zum Momentum der Gegenwart, das "zwischen dem, was war" liegt "und dem, was kommt", wo dann genau "die Entscheidung" angesiedelt ist.
Aber ist das ein "Augenblick des Nichts"? Jedenfalls kaum in Geschichte und Gesellschaft. Für die Einzelnen jedoch kann das durchaus so ausfallen. Täusche ich mich oder wird das Erkennen hier allein aufs Geworden-Sein bezogen, nicht ebenfalls auf das Sein im Werden? Wird Zukunft allein als ungewiss bestimmt? Gibt es noch Zuversicht? Oder nur "die Entscheidung, ins Ungewisse zu springen"?
Der Abschied von etwas, das seine Gültigkeit verloren hat. Und dann der erste Schritt auf unbekanntem Terrain, die Zukunft wie ein unbeschriebenes Blatt... Du tastest dich vorwärts, noch unsicher, hält der Boden? Ist da noch jemand? Oder Etwas?
Hier raunt es nicht zu knapp, ein bisschen wie in Texten der sogenannten Inneren Emigration vor siebzig Jahren. Fragen wir doch lieber, von welcher Vergangenheit und welcher Gegenwart wird hier gesprochen? Von welcher Zukunft, der vom "unbeschriebenen Blatt..., wo die gewohnten Parameter durcheinandergeraten: Hartes fühlt sich weich an und der Regen trocknet wie Stein"?
Und wie kann Kunst, wie kann Tanz dazu Stellung beziehen? Wie gestaltet sich der intersemiotische Übersetzungsprozess von Gedanken in Bewegung, von Wort in Tanz?
Auf dem Theaterzettel steht:
Was wir Erinnerung nennen, sind verschlossene Räume, die uns nicht nur in die Vergangenheit führen, sondern auch zum Anfang, zum Anfang aller Dinge.
Die Welt scheint in ihre Elemente aufgesplittert und fordert Sinn und Intuition heraus. Schutz und Orientierung suchend, tasten sich sechs Personen auf unsicherem Terrain vorwärts, straucheln und schlittern, finden Momente der Balance und Halt aneinander. Ihr Wille zur Veränderung bricht sich schäumend neue Bahnen, während bizarre Wesen ihre Wege kreuzen.
Natürlich, Orientierungslosigkeit und Schutzsuche betreffen in diesen immer komplexeren und komplizierteren Zeiten sicherlich viele Menschen auch ganz persönlich. Insofern ist das ein Thema, dessen Kunst sich annehmen muss und das tun Helge Letonja und sein Ensemble Of Curios Nature nun am Premierenabend, 16. Oktober 2020, vor einem wegen Corona notwendig spärlichem Publikum.
Fotos: Marianne Menke
Kaum wird der schwarze Vorhang aus Rombenketten geöffnet von dem Herrn, der davor sein Solo absolviert hatte und nun Kette für Kette abhängt, bietet sich dem Blick eine schaumbedeckte Bühne, was sofort Assoziationen auslöst. Von der Geburt der Aphrodite aus dem Meeresschaum und an die ersten Bilder, die einem dazu einfallen: Botticellis Geburt der Venus und dann zugleich wegen der frappanten Ähnlichkeit der Frauenfiguren auch seine La Primavera (Der Frühling). Dabei noch frisch die Worte im Kopf: "Ich zeugte ein Kind mit dem Frühling".
Im mythologisch so aufgewerteten Schaum, von dem in den Bildern und Skulpturen der Antike und der Renaissance allerdings recht wenig zu sehen ist, treten auf mit ihren hohen klobigen Plateaustiefeln zwei Figuren, die sich als sehr geübt zeigen, damit einen ganzen Zyklus von Bewegungen auszuführen, ja sogar zu tanzen, Annäherung und Distanz, verhaltene Aggressivität und Zuneigung zu demonstrieren. Im Zusammenhang dann mit dem kompletten Kollektiv der sechs Tänzer*innen gewinnt ihre Performance an stampfender Sicherheit mit so schwerem Schuhwerk in glitschiger Gischt.
Volle Zustimmung für Iris Hetscher :

Dazu passen jedenfalls die Musik von Simon Goff und der Text der Singer-Songwriterin Tara Nome Doyle mit ihrem Feel It All, hier in Auszügen in deutscher Übersetzung:

Neben diesem fast elegischen Song verwendet Simon Goff aus Berlin urbane und abstrakte Klangebenen, unterstützt von den Percussionisten Tobias Humble und Thor Harris.
Und schließlich auch noch ein Lied von Richard Strauss, Morgen! op. 27 no. 4, von dem das Video hier eine Vorstellung geben mag. Der Text ist von John Henry Mackay: "Und morgen wird die Sonne wieder scheinen/ Und auf dem Wege, den ich gehen werde/ Wird uns, die Glücklichen, sie wieder einen/ Inmitten dieser sonnenatmenden Erde// Und zu dem Strand, dem weiten, wogenblauen/ Werden wir still und langsam niedersteigen// Stumm werden wir uns in die Augen schauen/ Und auf uns sinkt des Glückes stummes Schweigen".
Entscheiden lässt sich nicht, ob fünf des Sextetts der Performer*innen Schaumgeborne sind wie die eingangs erwähnte Göttin der Mythologie. Doch: eher nicht. Nur eine einzige Figur namens "Kreatur" (Oh Changik) kann als solche gelten. Die andere steigen in das Schaumbett vom rückwärtigen Teil der Bühne ein, nachdem auch der dortige schwarze Rombenvorhang zum Teil abgebaut wurde, um ihnen Einlass zu gewähren.
Diese "Kreatur", am Besten zu sehen auf dem Titelfoto, ähnelt in der Tat einem dieser Perchten, diesen Gestalten in der Tradition des bayerisch-österreichischen Brauchtums (Kostümdesign Csenge Vass). Sich erst einmal aus dem Schaum erhoben, auf nach einer Stunde - trotz des Einsatzes einer Schaumkanone - im stetig tauendem Schneematsch, an Körper und Gliedmaßen, mit bluttriefenden Fleischlappen, so scheint´s, behängt, beginnt "Kreatur" im finalen Veits- oder Freiheitstanz alles Wässrige, ob Schaum oder Schnee, abzuschütteln. Und schließlich auf einer Lichtempore beweist sich dieser Protagonist orgiastisch-orgastisch als zu den Guten gehörig: zum Ende des Winters, zum Frühlingsanfang. Und vielleicht ein Kind zeugend?
Paul Kroker, Oktober 2020








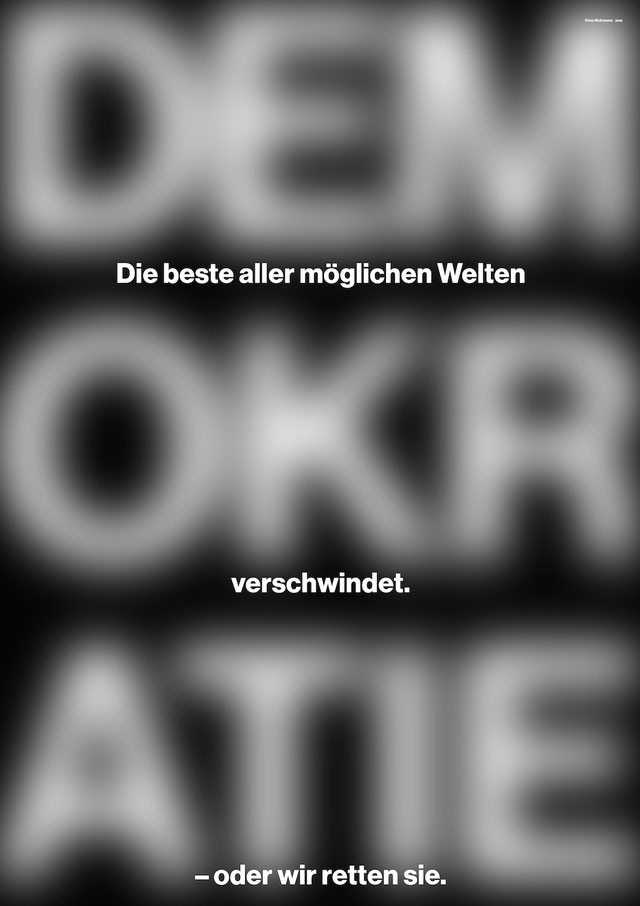

























Kommentar schreiben