
Folgt man der allerersten Rezension auf den Premierenabend am 18.1. in Hamburg, nämlich der von nachtkritik.de, dann war Karin Beiers Inszenierung am Schauspielhaus schlicht das „Highlight“ der laufenden Spielzeit dort. Denn „dieser Ivanov ist unbedingt sehenswert, ebenso lustig wie berührend“ (Stefan Forth). Und auch die meisten anderen Presseberichte loben die Inszenierung vollmundig. Bis auf den Spiegel, der im Aufführungsvergleich mit der zeitgleichen Bochumer Premiere, dieser fast den Vorzug zu geben scheint. Katja Weise (NDR) zeigt sich mit lobenden, doch auch kritischen Tönen eher ausgewogen. Nun denn.
Zunächst einmal gibt der Theaterzettel ein wohltuend klares, fast schon sachliches Resümee zum Thema dieses Abends mit Anton Čechovs Ivanov, einer Komödie, die sie eigentlich nie wirklich war und die sich dann fast folgerichtig zum Drama wandelt mit je einer – den Versionen von 1897 oder 1899 zufolge – tödlichen Variante im Finale.
Da heißt es also:
„Was ist los mit mir?“, fragt Ivanov seinen Nachbarn Pavel Lebedev. Ivanov versteht sich selbst nicht mehr. Früher hat er sich sozial engagiert, ließ Schulen bauen, setzte sich für politische Reformen ein. Mittlerweile ist ihm das alles egal, das ganze Leben ist ihm egal, selbst die hohen Schulden, die sein Gut belasten, rütteln ihn nicht wach. Einst hat er seine Frau Anna geliebt, die wegen dieser Liebe von ihrer jüdischen Familie verstoßen und enterbt wurde. Jetzt liebt er sie nicht mehr, kann sie nicht mehr lieben, obwohl er weiß, dass sie bald an Tuberkulose sterben wird. Genervt von den bedrückenden Verhältnissen zu Hause treibt es ihn abends aufs Nachbargut der Lebedevs. Zwischen deren Tochter Saša und ihm bahnt sich eine Liebelei an, doch sobald Ivanov mit ihr zusammen ist, möchte er allein sein, treibt es ihn wieder fort. Ivanov quält eine ziellose Energie, eine seelische Leere. Das provoziert seine Umwelt, die er gleichermaßen fasziniert und abstößt, wobei sich hinter dieser Fixierung auf ihn verbirgt, was diese Gesellschaft selbst aushöhlt, unterminiert: Ivanovs psychische Labilität spiegelt die Kälte, die Aggression, den Egoismus und die Kopflosigkeit einer Welt, die Zukunftsängste plagen, die spürt, dass ein grundlegender Wandel notwendig wäre, sich aber überfordert fühlt, die die Orientierung verliert und so in der Hoffnungslosigkeit landet.

Devid Striesow Fotografie: © Arno Declair
All das lässt Čechovs Stück für uns so unglaublich nah erscheinen: Jenen Stillstand der Zeit angesichts von „Hungersnöten, Seuchen Korruption, Pogrome gegen Juden, Restauration und Repression… im Russland des ausgehenden 19. Jahrhunderts“ (Rita Thiele). Heute noch ausgreifender als damals auf internationaler Skala und nicht nur wegen des ökologischen Notstands, den schon der Autor des Onkel Wanja diagnostizierte:
Die Wälder brechen zusammen unter den Hieben der Axt, Flüsse versanden und trocknen aus, die Tiere sterben, das Klima verschlechtert sic h, wunderschöne Landschaften verschwinden für immer und mit jedem Tag wird die Erde ärmer und hässlicher… Insgesamt kann man erkennen, dass ein Verfall eingesetzt hat, der bald alles zerstört haben wird. Und dieser Verfall ist die Folge von Ignoranz, Stumpfsinn und der totalen Unfähigkeit, sich seiner Zukunft anzunehmen.
Und Rita Thiele, Dramaturgin an der Seite der Regisseurin Karin Beier, führt in ihrem Essay im Programmheft weiter aus:
Die Herausforderungen unserer neoliberalen Welt, ihre ökonomischen und sozialen Deformationen münden für viele im Unglück und auch auf den Inseln der Privilegierten in Überforderung. Über das Versagen einzelner hinaus ist die Warnung, dass die Menschheit ihre Optionen auf eine Zukunft, die noch gestaltet werden kann, durch Passivität, durch „rasenden Stillstand“ (Virilio) verschleudert, nicht mehr zu verdrängen.
Heruntergebrochen auf das Individuum Ivanov führen die persönlichen und sozialen Zustände seiner Zeit zu einem psychischen Konglomerat aus, wie Čechov das in einem Brief von 1898 ausführt, „Ermüdung, Langeweile, Schuldgefühl und Einsamkeit“, so dass der „Jammerlappen“, wie er sich nennt und andere ihn rufen, unter der Last von Verschuldung und Verarmung, von todkranker Frau und Tändelei mit einer viel jüngeren zusammenbricht in einem dicht gedrängten Auf-und-ab höchster Erregung und folgender Apathie, Erschöpfung und Leere.
Ivanov ist bei all seiner Selbstbefragung und seinen Selbstzweifeln allerdings ein durchaus ehrlicher Charakter, worauf schon der Autor verweist: Er weiß nicht, was und wohin, und gesteht dies allerdings offen ein. Einerseits. Rechnet er sich auch selbst zu den Psychopathen, bleibt es andererseits dabei, dass sich für ihn alles um sein Ich und nur darum dreht. Wer ihm zu nah tritt wie seine todkranke jüdische Frau, kann durchaus aggressiv und rassistisch beschimpft werden.

Devid Striesow, Angelika Richter Fotografie: © Arno Declair
Auch sonst ist da niemand, der Antwort wüsste und Hilfe böte – nicht im Text und nicht auf der Bühne. Weder der „ehrenhafte, beschränkte und eingleisige“ Doktor Lvov (Samuel Weiss), der Tugenwächter v.D., ein durch und durch falscher Hase, am Ende stockbetrunken mit der Wodkaflasche in der Hand. Noch die sich anbietende Liebe der Saša (Aenne Schwarz), „die die Männer in der Phase ihres Fallens liebt…“ und keinesfalls „mit der Farbenpracht ihres Gefieders“ zu erobern ist. „Sie liebt nicht Ivanov, sondern die Aufgabe“ ihm wieder auf die Beine zu helfen (alle Zitate, o.g. Brief Čechovs).
Existentielle Hilfe ist auch nicht von den beiden aus der Vätergeneration zu erwarten, nicht vom zukünftigen Schwiegervater Lebedev (Michael Wittenborn) und nicht vom verarmten Onkel Graf Šabelskij (Ernst Stötzner). Diese beiden Nebenfiguren allerdings beleben geradezu die Bühne mit ihrer Schauspielkunst als Charaktere von einer Wahrhaftigkeit, die aus ihrer widersprüchlichen Lebenssituation resultiert, einmal der finanziellen und psychischen Abhängigkeit von Ehefrau oder Neffen und zum anderen der eigenen Lebenswünsche. Lebedev hat da schon kapituliert und ertränkt alles im Wodka, der Onkel hingegen sieht sich fast verführt, die reiche und noch junge Witwe Babakina (Lina Beckmann) zu ehelichen, würde am liebsten jedoch ans Pariser Grab seiner Frau. Stötzner und Wittenborn ist es in ihrer Tragikomik zu danken, dass der Abend schauspielerisch gerettet wird, indem sie ihre Rollen dankbar ausschlachten.
Während Eva Mattes als Frau Lebedev, die über die hauseigenen Finanzen wacht, nicht an ihre sonstige Klasse heranreicht.

Bastian Reiber (l), Michael Wittenborn, Ernst Stötzner (r) Foto: © Arno Declair
Nur nebenbei: Dass sie zig Tönnchen Stachelbeer-Varenje auf die Szene transportiert, was dem Publikum dann als Marmelade vorgestellt wird, muss natürlich missverständlich bleiben. Denn es handelt sich tatsächlich um eingelegtes Obst, das wie heute bei Cocktails damals mit Tee oder Wasser genommen werden konnte.
Die „jungen Gäste bei den Lebedevs“ (Programmheft) bleiben das, was sie sind, bloß Statist*innen im „öden“ (so die Babakina) Partyambiente so realitätsnahe wie klischeehafte Feierbiester, dass jede weitere Erinnerung an sie schnell verblasst. Der Eindruck, dass ihnen von der Regie mehr soziale Präsenz zugestanden wird im Sinne einer Aktualisierung des Themas, legen auch bestimmte alltagssprachliche Floskeln nahe.

Fotografie: © Arno Declair
Dabei bietet die hohe schwarze Bühne mit ihren spärlichen Beleuchtungsaccessoires einen idealen Traumraum für kleine und große Dramen, wird aber überwiegend nur im nahen Vordergrund und nicht in ihrer ganzen Weite genutzt. Was irgendwo wirkt wie die räumliche Spiegelung mangelnder Tiefenschärfe vieler Figuren und Szenen.
Das trifft leider auch für den Ivanov des Devid Striesow zu, festgefroren auf ein Minimum an Mimik und Gestik bei aller hektischer Darstellung einer Empfindung von Leere, die er im Video ja für sich selbst als elementar reklamiert. Nach der Pause dann erste Anzeichen einer Lockerung, die wir diesem so oft überzeugenden Schauspieler und dem ganzen Ensemble von Herzen wünschen.
Denn die reduzierten Ausdrucksmöglichkeiten betreffen auch das audiovisuelle Gesamt, die Rezitation verkam leider im Verlauf der drei Stunden am Premierenabend zum hohlen Geschrei, wovon auch Aenne Schwarz als Ivanovs letzte Liebe nicht verschont blieb.
Diese Bühnenkünstler*innen können es wirklich besser und also setzen wir auf die Vermutung, dass diese Erstaufführung offensichtlich auf eine allzu glänzende Generalprobe folgte.
Und auch darauf, dass die ultimative Szene von Ivanovs Suizid, dessen finaler Schuss von einem geplatzten Luftballon intoniert wird (kein schlechter Einfall!), ihren Slapstickcharakter verliert oder ganz entfällt wie in Čechovs Version von 1897. Wohingegen in der von 1899 der Freitod des Protagonisten seinen dramatischen Wert geltend macht.
Wundervoll die musikalische Untermalung am Altsaxofon von Vlatko Kucan als Solist, der sich sehr gut auch in die elektronische Klangkulisse (Jörg Gollasch) einzupassen versteht. Der Musiker übernimmt darüber hinaus noch die Rolle des Dieners Gavrila im Hause der Lebedevs.

Das kleine Programmheft zur Inszenierung bietet neben vielen Szenenfotos einige Texte mit Reflektionen über Situation und Gesellschaft im neuen Jahrtausend. Durchaus angebracht, insofern sich ja Parallelen zum Russland Ende des 19.Jahrhunderts anhand von Čechovs Text ausmachen lassen.
Würde dann aber nicht wenigstens historisch wie aktuell irgendwo angemerkt sein sollen, dass die damalige russische Gesellschaft sich in weniger als dreißig Jahren grundlegend veränderte. Also Geschichte ohne Bewegung, Evolution und Revolution undenkbar sei, ohne ständige Veränderungen eben (nicht immer zum Besseren). Und dass dann auch Gegenwart mehr ist, als sich in jener Generation überdrehter partyvergessener Hipster und Egomanen präsentieren kann.
Nicht nur freitags gibt´s auch anderes in unserer Zeit.
Paul Kroker








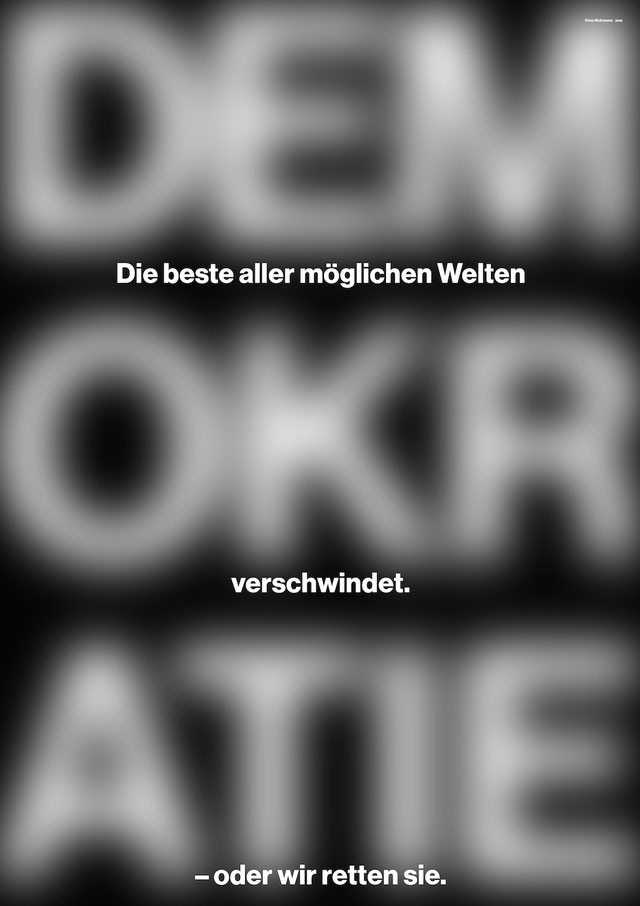

















Kommentar schreiben