
Fotografie: Kerstin Schomburg
„Inzwischen war es November. Nach dem November kommt der Dezember. Danach Januar, Februar, März und April. Nach dem April kommt der Mai. Juni, Juli und August folgen. Es folgt der September. Dann der Oktober, und siehe da, schon sind wie wieder beim angelangt und haben ein ganzes Jahr absolviert.“
Worte, eingangs auf die Stoffbahnen des Bühnenvorhangs projiziert und literarisch so banal, wie sie zugleich präzis angeben, was in Orlando, eine Biografie geschieht, in der Zeit unmittelbar vor der Publikation des Lebensberichts im Jahre 1928: „Sie schrieb. Sie schrieb. Sie schrieb.“
Und das entspricht den Fakten, wie es auch Fiktion ist. Denn einmal publiziert The Hogarth Press in der Tat in diesem Jahr den Roman Virginia Woolfs, im englischen Original: Orlando, The Biography. Zum anderen schreibt die Autorin hier auch über ihr eigene Schreibsituation, wählt dazu mehrere Rollen, um umfassend zu thematisieren, wie traumhaft und traumatisch die Verhältnisse im Laufe der Geschichte geworden, die ewige Grundfragen menschlicher Existenz aufwerfen: „Was ist Leben? Was ist Liebe? Was ist Literatur? Was ist Wahrheit?“ Insofern ist Orlando als Text sowohl autobiografisch wie biografisch, nicht nur aber auch weil sich hinter den Erfahrungen des/der Protagonist*in Orlando das Leben der und die Liebe zu der Schriftstellerin und Geliebten Vita Sackville-West auftun. Deren Sohn Nigel Nicholson nannte das Buch „den längsten und bezauberndsten Liebesbrief in der Literatur“. Und wohl nicht zufällig hat die Abbildung von einem Gemälde im Romantext, die den späteren Ehemann Orlandos vorstellt, erstaunliche Ähnlichkeit mit eben dieser Freundin und Geliebten Vita.
In all den geschilderten phantasievollen Wirrnissen, aller Ironie und Groteske der Historie und in den Geschlechterverhältnissen treten Lebenswunsch wie auch -zweifel zu Tage, die es nicht als Versehen erscheinen lassen, dass diese Publikation fast mittig eingerahmt wird vom ersten versuchten Suizid 1913 und dem schließlichen Freitod Virginia Woolfs 1941.
Existentielle Hamlet-Momente der Schwermut, ebenso von Todessehnsucht, blitzen mitunter auch auf der Bühne auf.

Solch Profundität könnte bei all der Spritzigkeit und Spielfreude der Hannoveraner Inszenierung fast verloren gehen, allerdings kaum die zentrale Identitätsproblematik, die die Erzählerin am Ende des Romans noch einmal explizit anspricht:
„Sie (i.e. Orlando) verfügte nämlich über eine Vielzahl an Ichs, die sie herbeizitieren konnte, wesentlich mehr, als wir unterzubringen uns imstande sahen, denn eine Biografie gilt als abgeschlossen, wenn sie lediglich sechs oder sieben Ichs abhandelt, obwohl ein Mensch viele Tausende aufweisen kann.“
Wie der Text den Tanz nicht nur der Geschlechteridentitäten durch die Jahrhunderte durchspielt – und das war vor fast hundert Jahren alles andere als eine Selbstverständlichkeit, so können seine aktuellen Bühnenadaptionen in Dortmund, Berlin oder eben in Hannover das heute im Einklang wie natürlich auch im Widerspruch zum herrschenden Zeitgeist tun. Auf der Bühne, wie in der Kunst überhaupt, ist es ja mehr als nur erlaubt, damit spielerisch umzugehen.
Und das tun die im Staatstheater Hannover mit ihrem Zwei-Personen-Stück wirklich gut. Corinna Harfouch als androgyne Orlando-Figur, aber fast wichtiger noch, weil es noch treffender ihre schauspielerischen Qualitäten aufruft, als biografische Erzählerin, im graugrünen Military-Look schon in früheren Jahrhunderten für eine weichere Männlichkeit einstehend (Kostüme: Jelena Miletic).
Ihr Sparringspartner auf der Bühne, Oscar Olivo, verkörpert gekonnt diverse Figuren vor allem die von Frauen. Allerdings auch die des Marmaduke Bonthrop Shelmerdine, Esquire, von dem Orlando schließlich ein Kind erwartet. Rätselhaft-bezaubernde Krinolinen-Szene, die den Sekundenmoment der Liebe zwischen Orlando und dem ersten und einzigen Mann in der intimen Nähe des Reifrocks, was zugleich auch mögliche Gefahren andeutet, die aus dieser Enge erwachsen könnten.

Beide, Schauspielerin und Schauspieler, in der Vergangenheit schon gemeinsam an der Hannoveraner Bühne, kennen sich gut und Harfouch empfiehlt der Regisseurin Lily Sykes das Engagement des gebürtigen New Yorkers.
Wie schön er die erste große unvergessliche Liebe Orlandos zur russischen Adligen mit dem Kosenamen Sascha vortanzt, das ist so geschmeidig, großartig grotesk und wird fotografisch hier auch treffend wiedergegeben:

Dass zu elisabethanischen Zeiten die gealterte Queen, sich des Talents, der Schönheit und der erotischen Ausstrahlung des jungen Höflings Orlando annimmt und ihn reich beschenkt, dass sie deshalb in der Inszenierung zur bloßen Karikatur einer greisen sexlustigen Herrscherin gerinnt, könnte einen faden Beigeschmack hinterlassen. Ohne größere aktuelle Zusammenhänge zu zitieren, wissen wir´s doch eigentlich besser spätestens seit der Film-Ikone Harold and Maude (1971).

Was aber den beiden Akteuren und der Regisseurin wirklich gelingt, ist eine außerordentlich unterhaltsame Bühnenadaption, nur ausnahmsweise mal klamaukhaft, in der Regel dem thematischen Anliegen der Romanautorin entsprechend und vor allem einem zeitgeistlichen Publikum, das sich – vor allem wenn in Unkenntnis des Textes – der Tiefenwirkung seiner gerade erfahrenen Vergnügungen erst einmal selber klarwerden muss.
Was vom Bühnenbild (Jelena Nagorny) nachdrücklich unterstützt wird, minimalistisch mit einem wandhohen Scheinwerfergestell und einigen wenigen, multipel verwendbaren Requisiten.
Roman und Theaterstück sind ja keine bloße Harlekinade, obwohl sie das auch sind, bewusst von der Autorin (und auch in der Regie von Lily Sykes++) so in Szene gesetzt, die sich eine Eskapade nicht nur aus ihrem Schriftstellerinnen-Dasein erlauben wollte. Und dann auch in den Schlussworten ihrer Protagonistin auf der Bühne: „Ekstase“ also, das Heraus aus den aufgezwungenen, übernommenen Rollen, und dem Anderen zu: dem Akzeptieren neuer Identitäten, die schon immer in einem schlummerten. Geschlechtlich, sozial, ästhetisch, poetisch – „viele Tausende Ichs“ eben.








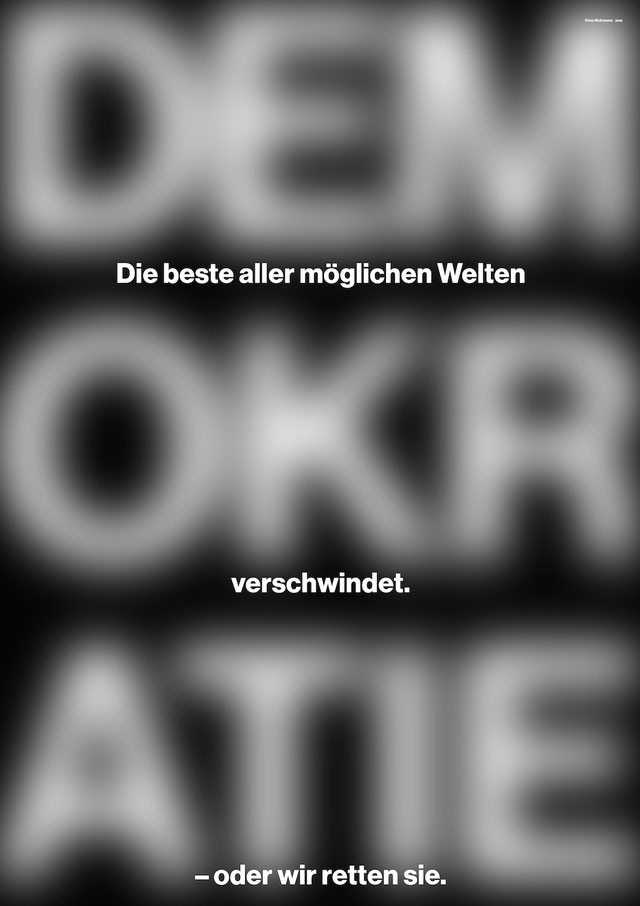


















Kommentar schreiben