
Die neue Spielzeit von Thalia international wird eröffnet mit einer Pariser Produktion, von Theatern in Wien, Amsterdam, Florenz und eben den Hamburgern koproduziert. Und so international ist ebenfalls die Besetzung dieser Deutschland-Premiere von „Mary Said What She Said“: Robert Wilson (Regie, Bühne, Licht), die wunderbare Isabelle Huppert, Darryl Pinckney (Autor) und Ludovico Einaudi (Musik). Neu in diesem Quartett ist nur der italienische Komponist, der sich mit seinem Minimalismus absolut kongenial einpasst. Die anderen kennen sich schon bestens aus jahrzehntelanger Zusammenarbeit und sind auch im Thalia-Theater längst keine Unbekannten.
Absolut hochkarätig gleichfalls der historische Stoff im deutschsprachigen Raum alles andere als fremd dank des lange Zeit schulpflichtigen Dramas von Friedrich Schiller und des biografischen Romans von Stefan Zweig. Was an Pinckneys Text und Wilsons Inszenierung neu ist, dass daraus eine fast neunzigminütige Soloperformance am Abend vor der Hinrichtung der schottischen Königin im Februar 1587 wird.

Auftritt Isabelle Huppert mit dem Monolog der Maria Stuart – nach ihrem letzten Brief an den Schwager, Henri III. von Frankreich, „einem dreiteiligen, aus 86 Absätzen bestehenden Monolog“ (Programmheft), von Pinckney zu einem großen Bewusstseinsstrom komponiert.
Doch, halt! Da läuft noch vor geschlossenem, kunstvoll drapiertem Vorhang in majestätischem Rot in einem kleinen goldenen Bilderrahmen ein Stummfilm-Clip zu Drehorgelmusik, beides in Endlosschleife: ein kleiner schwarzweißer Hund auf der Jagd nach seinem eigenen Schwanz, untertitelt: „You fool me, I'm not too smart.“ Dem schien ein Großteil des Publikums kaum Beachtung zu schenken.

Nun endlich aber Vorhang auf und da steht sie unbeweglich: Isabelle Huppert als Mary, die als Königin so perfekt wie die Schauspielerin die französische Sprache beherrscht, mit der sie ja aufwuchs. Eine kleine dunkle vornehm gekleidete schwarze Silhouette bloß, vor hellem Hintergrund, die zu ihren ersten Worten fast unmerklich, ganz langsam nach vorne schwebt. Doch die Königin bleibt lange noch im Schatten, in dessen Reich sie alsbald ganz verschwinden soll.
Das Königtum allerdings, war ihr im Alter von sechs Tagen schon in die Wiege gelegt, da war sie bereits, zwar nie unumstritten, „die einzige und alleinige Maria von Schottland und den Inseln“. Mit siebzehn Jahren wird sie auch noch auf ein Jahr an der Seite François II. Königin von Frankreich.
So eingefroren in ihren Bewegungen, ganz anders dagegen ihre Sprache, die in atemberaubendem Tempo und immer absolut präzise artikuliert, beginnend mit „Erinnerung schütte dein Herz aus“. Ein immer länger währendes Stakkato der wegen angeblichen Putschversuchs zum Tode verurteilten Mary von Schottland, um am Vorabend ihres Todes das Drama ihres Lebens nachzuzeichnen.

Im Pressegespräch vor der Aufführung stellt Robert Wilson die große Gabe zur „Abstraktion“ von Isabelle Huppert heraus, die er selbst bei Marlene Dietrich vor rund einem halben Jahrhundert kennen gelernt hatte, nämlich Mimik und Gestik durchaus im Kontrast zur Stimme und ihren Klangfarben einzusetzen.
Mit welchen Nuancen so etwas abgeht, zeigt Huppert, wenn sie sekundenlang tonlos mit aufgerissenem Mund verharrt. Wenn sie im Finale zum stampfenden Rhythmus der Musik immer wieder quer über die Bühne marschiert mit grotesken Armbewegungen, die an Joe Cocker erinnern lassen. Wenn Mary sich erinnert, als Mädchen bei der Mätresse von Henri II. tanzen gelernt zu haben, und dabei ihren Körper dreht und aus der Bewegung in unsicheres Trippeln verfällt, was mimetisch gedeutet werden könnte, aber es nicht ist, weil es die wohlgefällige Erinnerung an vergangene Kindheitstage konterkariert.

Im Unterschied zu Schillers Frauenfigur kann sich bei dieser Maria Stuart spontan kein Mitgefühl einstellen. Diese Frau ist ohne Zweifel Opfer, die – ständig im Clinch zudem noch mit dem eigenen Adel und den Protestanten im Lande – schließlich im Konkurrenzkampf der Königinnen unterliegt und nach achtzehn Jahren Hausarrest von Elisabeth I. eiskalt zum Tod durch das Beil übergeben wird. Zwei Hochzeiten, eine Liebschaft oder mehr, Tod und Mord – bei alldem geht es zugleich immer um Machtfragen und Mary, was immer sie sagt und beklagt in all ihrem Leiden, ist immer auch Täterin im Kampf um die Macht, Königin nicht nur von Schottland zu sein, sondern gleichfalls von England zu werden. Eine Getriebene wie jener kleine Hund im Video und wähnt sich dazu noch von Gott berufen.

Mary kann so grandios Urteil und Schafott kompensieren: Sie redet und redet und redet, wiederholt sich in einem fort, denn „In meinem Ende liegt mein Anfang“. Sie wortet ohne Unterlass ihr erlebtes Schicksal von Gewalt und Liebe, Leiden und Leidenschaft selbst noch nach den gewaltig donnernden drei Hieben des Beils in den Händen des trunkenen Henkers – aus dem Jenseits. So artifiziell, oft gar ungelenk sie sich dazu bewegt, sie tut es nicht als Marionette – wessen auch? – sondern in Korrespondenz mit einem, der ihr vielleicht Gehör schenken möchte in der Stunde ihres Abschieds von dieser Welt.
Im gezielt platzierten Bühnennebel, wolkig durchaus Transzendenz verkündend, verstummt sie keineswegs. Sie ist widerständig, ein berechtigter Widerstand gegen das Verschwinden von historischen Frauengestalten aus der Geschichte, wie sie aus den Büchern von Männern überliefert wird.
Dem allem hat Ludovico Einaudi einen Soundteppich unterlegt von seinem neuen Album, der dem Bühnen- und Sprachgeschehen eine klangliche Dimension zuliefert, die der minimalistischen licht- und regietechnischen Gestaltung durchaus entspricht. Bei anfänglich vielleicht etwas zu übermäßig akzentuierten melodramatischen Klanggebilden, die sich nicht scheuen, hier und da auch ihre barocken Vorfahren zu zitieren. Das passt schon.
Solch Theater geht nicht sofort unter die Haut, sondern erst ins Gehirn, zum Nach-denken.









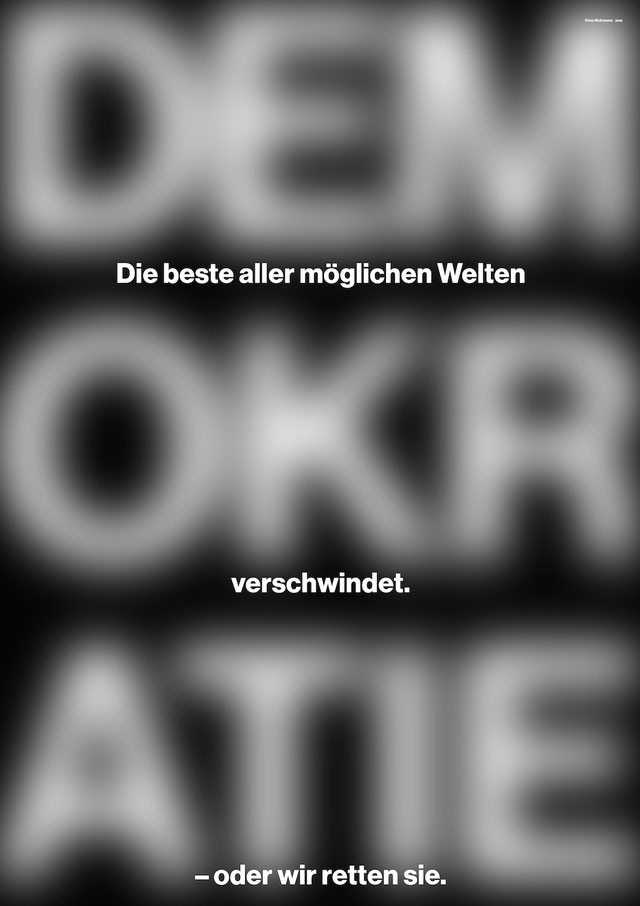
















Kommentar schreiben
Fulvia Milton (Donnerstag, 03 Oktober 2019 07:43)
Inspiring and both brain- and heart-felt review.