Fotografie: Sebastien Dupouey

Vorweg: Dank der Inszenierung von Falk Richter und zweier aufschlussreicher Quellen, die das interessante Programmheft anzeigt, komme ich auf einige Gedanken, wozu mich die bloße Lektüre von Serotonin nicht motivieren konnte. Und ich sage auch jetzt noch wie vor ein paar Wochen: Dieser Roman vom bejubelten Michel Houellebecq ist misslungen.
Aber der Reihe nach. Zunächst zu den Ausführungen von Ines Kappert in einem schon älteren Artikel der TAZ, der sich ganz grundsätzlich mit der Rolle des Mannes in der Krise, als Opfer sozialer Prozesse, befasst, der sich zu
Per Klick zur TAZ
Und genau hier komme Michel Houellebecq ins Spiel, denn seine „Antihelden zählen zu den bis heute berühmtesten Verlierertypen in der Belletristik… Allerdings nicht als traurige Rebellen wie etwa ein James Dean, sondern als Patienten.“
Soweit Ines Kappert.
In der Tat des Schriftstellers Männerbild ist in seiner ganzen depressiven Schwäche geradezu unerbittlich: Der total abgehalfterte Florent-Claude Labrouste in Serotonin vegetiert dahin, körperlich ein Wrack, geistig sich dessen und mehr bewusst, psychologisch festgezurrt in der Opferrolle gegenüber allem und jedem. Auf dass er, das selbstbekennende „Weichei“, auch an seiner finalen Wahnsinnstat, dem Kindsmord, scheitert. Er, der im Angesicht seiner „kleinen weißen, ovalen, teilbaren Tablette“ das Lob Gottes und das Zeichen Christi bemüht, um seine Reue zu bekennen, die „eine Frau“ nicht glücklich gemacht zu haben, „oder vielmehr zwei“. Er will seinerseits ein Zeichen setzen und sein „Leben für diese Erbärmlichen“ geben. Ob er´s denn tut, wissen wir nicht, Zweifel sind angebracht.
Nun aber der Autor selbst zu seiner Poetik mit einer geradezu programmatischen Erklärung anlässlich der ihm gewidmeten Ausstellung in Paris 2016
Per Klick zum Spiegel 5/2016
Doch schon Kafka sprach von der der Literatur als „Axt für das gefrorene Meer in uns“, also nichts wirklich Neues dieser so „unerwartete Stoß“, den dieser Autor da austeilen möchte.
Was er bezogen auf seine Ausstellung mit dem Titel „Lebendig bleiben“ sagt, gilt pars pro toto wohl auch für sein Schreiben insgesamt. Wobei die Essenz von Leben und Schreiben vom Autor so bestimmt wird:
„In der Erfahrung des Leidens entwickelt sich ein tiefes Ressentiment gegen das Leben. Lernen, ein Dichter zu werden, heißt, zu leben verlernen. Aber die Wahrheit muss gesagt werden und ein toter Dichter schreibt nicht mehr.“
Seine Poetik intendiert also als vorgeblich gefühllose, vorurteilsfreie Deskription der Realität, als implizite Kritik an menschlichen und gesellschaftlichen Verhältnissen, als Dokumentation, die einfach als solche zu Kunst erklärt wird? Literarische Konzeptkunst? Meinetwegen.
Allerdings sollen hierbei Grundkategorien künstlerischen Schaffens wie Ästhetik und Ethik ausschließlich von ihrer Schattenseite gesehen werden. Und Dialektik auf reine Negation beschränkt, was sie außer Kraft setzt. Als Abschied von Welt in ihrer ganzen Widersprüchlichkeit. Das geht als Fiktion natürlich durch. Aber ist das eine Poetik, die – wen denn? – zu überzeugen vermag?
Ein Mord, der keiner wird.
Zugegeben, es sind nicht einmal zehn von dreihundertfünfunddreißig Seiten, auf denen Houellebecq seinen Antihelden den Plan zur Rückgewinnung seiner Ex-Geliebten aushecken lässt und zwar mittels der Ermordung ihres vierjährigen Sohnes, um so die „symbiotische“ Mutter-Kind-Beziehung aufzukündigen – per Schuss aus einem Präzisionsgewehr. Um den Fokus der Frau langfristig wenigstens wieder ausschließlich auf sich, den ach so schräg Liebenden, ausrichten zu können. Was bringt mir Leser*innen das, solche brutale Scheußlichkeit, die ja in der Tat bloß die Hässlichkeit in der Welt wie medial üblich dokumentarisch reproduziert. Laut Houellebecq ist das schon Kunst. Doch die Frage bleibt: Wie entwickelt sich hieraus eine poetische Dimension?
Nun war die Theater-Premiere vor ein paar Tagen der eigentliche Grund für die Lektüre dieses Romans. Und umso überraschender das durchaus kurzweilige Anrauschen dieses Bühnenspektakels. Hervorgerufen durch das Auffächern des Florent-Claude Labrouste in vier männliche plus zwei weibliche Figuren, die eingangs rechts und links in einer Loge des ersten Ranges seine Spanien-Erzählung deklamierten. Das zündete zunächst mal, versprach Verve und vielleicht dramatisch und psychologisch sogar noch mehr.
Die Enttäuschung folgte auf dem Fuße, als nun tatsächlich eine Nummernrevue abzulaufen begann, sozusagen Boulevardtheater, vielleicht auf höherem Niveau? Besonders augenfällig, als nun das Herrenquartett mit verteilten Rollen ein Wiedersehen inszenieren von Labrouste mit seiner Ex-Geliebten Claire, einem Eintags-Theaterstar und danach die mit dem Hang zur Flasche. Das war zwar fast buchgetreu, doch auf der Bühne wird´s noch einen Tick gemeiner und billiger: Schmierenkomödie eben. Wenn der Macker mit der blonden Perücke (Tilman Strauss) die besoffne geile Alte gibt und die macht sich dann über des andern Hosenschlitz her.

Doch es geht auch anders in dieser Aufführung: zum Beispiel die Behandlung der wichtigsten aller Liebesbeziehungen von Florent: nämlich der zu Camille, der Tiermedizinstudentin. Die musste der lüsterne, mindestens doppelt so alte weiße Mann fernab der Heimat an einem typischen Konferenzabend mit Tam von den britischen Delegation wegen ihres „hübschen kleinen schwarzen Hinterns“ wider besseren Wissens betrügen. Was dann eben rauskommt und Camille ihn verlässt.
Und an dieser Stelle befreit sich die Inszenierung von der Romanvorlage und wird wirkliches Theater, probiert etwas Eigenes, nämlich auszubrechen aus der dominierenden Sicht des erzählenden Florent und der verletzten Camille eine eigene Stimme zu geben. Und das funktioniert. Ergreifend gut, wenn Josefine Israel, die von sich noch nicht als Popsängerin reden machte, anrührend anstimmt The Power of Love. Nicht die etwas schnulzige Version von Celine Dion, doch mit dem bewegenden Refrain im Angesicht seines Seitensprungs: Cause I'm your lady / And you are my man.
Einer der wenigen Augenblicke, wo einer Emotion nachgespürt werden kann und in der Bühnenfigur Melancholie und Trauer fühlbar werden.
Umso mehr kontrastiert diese Szene mit dem großen Ganzen dieser Inszenierung, die einem verkommenen zersplitterten Roman- und Bühnen-Ich alle Aufmerksamkeit widmet. Ja, bloß keine Einfühlung! Immer möglichst grotesk, überzeichnet, Abscheu aller Orten. Dabei bleibt natürlich niemand das Lachen im Halse stecken. Es bleibt eben Unterhaltung, gute sogar: Langweile absolut fehl am Platz.
Nur ist das kein Theater, das mehr zu bieten hätte. Da werden persönliche Katastrophen ebenso abgehakt wie die sozialen der Landwirte der französischen Milchwirtschaft angesichts der offiziellen EU-Politik. Und trotzdem genau an diesem Punkt ist der Roman viel akzentuierter in der dramatischen Zuspitzung des Konflikts als das medial gut aufbereitete Bühnenspektakel.
Dann aber Pause.
Und uns beschleicht die Erinnerung an die großartige Inszenierung des letzten Houellebecque-Stücks in diesem Theater, dem dann noch die geniale Filmversion des Neffen von Edgar Selge folgte.
Was konnte jetzt noch kommen? Da war schon so viel geliefert worden an personalem und materiellem Einsatz, an Bühnen- und Lichttechnik. Allein beim Bauernaufstand unter Führung von Aymeric (Carlo Ljubeck), dem aristokratischen Freund von Labrouste, dem auf der Bühne allerdings der melodramatischen Suizid versagt bleibt.
Sicher, auch die folgenden Aufnahmen bildtechnisch erinnerungswürdig: die Szene mit drei der vier Hauptdarsteller als aufgedunsene, dicke fette rosa Schweinchen (Jan-Peter Kampwirth, Samuel Weiss, C.Ljubeck) in der noch viel rosaneren Box, davor der vierte im zottigen Toni-Erdmann-Pelz (Tilman Strauss) – alles wohl Anspielungen auf die physisch-hygienischen Mutationen von Florent-Claude, einem nurmehr vor sich hin vegetierenden Etwas, Pillen schluckend, doch immer noch zu hochfahrenden megalomanen gedanklichen Konstrukten fähig:
Warum auch der Roman poetisch nicht von der Stelle kommt, wird mir erst bei seiner theatralischen Übersetzung wirklich klar. Dabei ist es so einfach: dem Text im Buch und auf der Bühne fehlt, obwohl er sich davon umstellt und ins Hintertreffen gestürzt wähnt, – ihm fehlt: Welt, Welthaltigkeit. Die dialektische Vielfalt des Lebens. Er ist einseitig, dogmatisch, negativ auf seine eigenen Schwächen und die der anderen fokussiert und stände, wäre er politisch klassifizierbar, bei der Rechten in Frankreich und in Deutschland, was der wertkonservative Autor für sich 2016 noch bestreitet.
Sein Anti-Held ist der kulturelle Prototyp all derer, die sich ausgeschlossen wähnen von allem, von Chancen und Gerechtigkeit und Mitspracherecht, von Traditionen und Werten, auch solchen, die die Geschichte längst überholt hat, die doch aber bitte bewahrt bleiben sollten wie zum Beispiel die Gender-Hierarchie. Und die sich eilends Billigst-T-Shirts aus Thailand mit Heimat-Parolen in Runenschrift überstreifen und begeistert die rechte Hand zum Vernichtungsgruß heben.
Um aber unsere Gegenwart einem wirklich verfremdenden Blick auszusetzen, aus dem sich ethischer wie ästhetischer Gewinn ziehen lässt, reicht das poetologische Programm Houellebecqs vorne und hinten nicht. Das aber muss Kunst nicht nur heute leisten, sondern wie immer schon, mal mit Erfolg, mal mit weniger.
Brecht wäre immer noch weiterzudenken, nicht nur, um bei Heiner Müller anzukommen, sondern weiter: Versuche über Versuche, Leben und Kunst stecken voller Möglichkeiten. Und Scheitern gehört dazu.
Deshalb schließen wir uns dem langanhaltenden Applaus gerne an.
Houellebecq produziert höchst erfolgreich Endzeitstimmung. Das kann man, muss man jedoch nicht goutieren. Sollte man auf jeden Fall unbedingt diskutieren, und nicht einfach zur Tagesordnung übergehen.








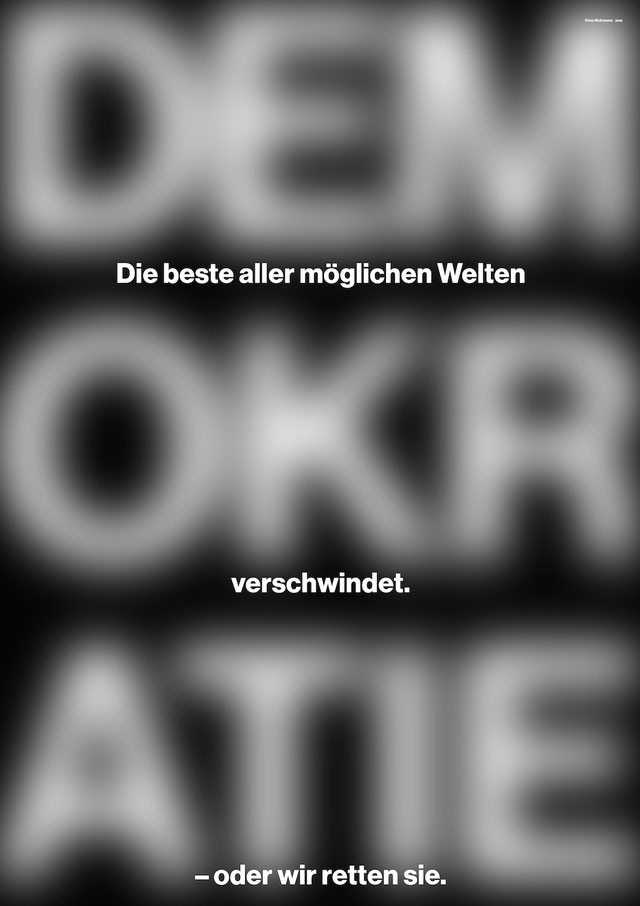
































Kommentar schreiben