
Amala Dianor, fast noch ein Newcomer in der internationalen Tanzszene, hat mit The Falling Stardust das Festival „Tanztheater International“ in Hannover eröffnet.
Im Senegal geboren, kommt er als Kind nach Paris und wächst schnell, nach seinen Worten den „Rhythmus im Blut“, zu einem tanzbegeisterten jungen Mann heran, der sich in der Hip-Hop-Szenerie zu profilieren beginnt. Um die Jahrtausendwende kann der damalige Mitzwanziger zeitgenössischen Tanz in Angers studieren und entdeckt zugleich seine Faszination für die Choreografie. Zehn Jahre später gründet er seine eigene Compagnie, entwickelt in kürzester Zeit ein Dutzend eigener Stücke, von denen der größte Teil aktuell auf französischen Bühnen zu sehen ist.
Mit seiner neuesten Kreation „Sternenstaub“, zuletzt im Juni beim Festival Montpellier Danse, zeigt er in ausgereifter Form, worum es ihm in seiner Ästhetik geht. Vielleicht könnte man eine Ahnung davon bereits anhand der Zusammensetzung seines Ensembles und der verschiedenen Biografien bekommen: Vier Tänzer*innen kommen vom Ballett und dem klassischen Tanz, je zwei vom Hip-Hop und dem modernen Tanz und eine, Sandra Mercky, hat von Anfang an gar alles auf dem Schirm.
Nun ist es Dianors erklärte Intention, mit seinem Nonett aus sieben Tänzerinnen und zwei Tänzern eine Performance zu entwickeln, die ein neues ästhetisches Koordinatensystem entwickelt. Dass sich darin Risiken bergen, aber natürlich auch künstlerische Chancen, ist dem Choreografen natürlich klar. Offensichtlich setzt er auf die Lernbereitschaft und -fähigkeit seiner Virtuos*innen, sich in den jeweils anderen Techniken, also auf „weniger stabilem Territorium“ (A. Dianor), vielleicht ebenfalls die Meisterschaft zu erarbeiten. Ja: vielleicht. Aber kommt es wirklich darauf an? Geht es nicht eher um den Versuch, ums künstlerische Experiment? Das natürlich auch zu einem krönenden Abschluss führen kann, aber nicht muss.
In schwarzer Sportkleidung betritt das Ensemble die Bühne, den Raum erstmal schreitend vermessend. Wichtig, wenn dann auf kleinstem Raum zu gewagten hohen und weiten Sprüngen angesetzt wird. Variationsreich die Bewegungsabläufe in unterschiedlichsten Formationen, mal als Solo, dann zu zweit, dritt, viert und fünft, in Aktion oder im plötzlichen Stillstand. Gar als zuschauendes Publikum on stage. Fließende Bewegungen, Ballettfiguren mit Spitzentanz wechseln sich ab mit urplötzlich abgehackter, ruckartiger Gestik von Kopf, Hüfte und Gliedern. All das hauptsächlich in der Vertikale oder gar in der Luft, dann aber auch mal akrobatisch am Boden. Das alles verweist auf die harte Arbeit – die US-amerikanische Choreografin Deborah Hay nennt es „Hundearbeit“ – der Tänzer*innen, die mehrmals sich untereinander per Blick und Mimik verständigen.
Solch tänzerischer Formenreichtum hier zur durchaus kongenialen Musikkomposition von Awir Leon kann durchaus mit den Worten eines französischen Kritikers bezeichnet werden als „beunruhigende Leichtigkeit“.
Eine Leichtigkeit, die vom Video in seinem Beton-Setting mit gestiefelten Tänzer*innen leider konterkariert wird.








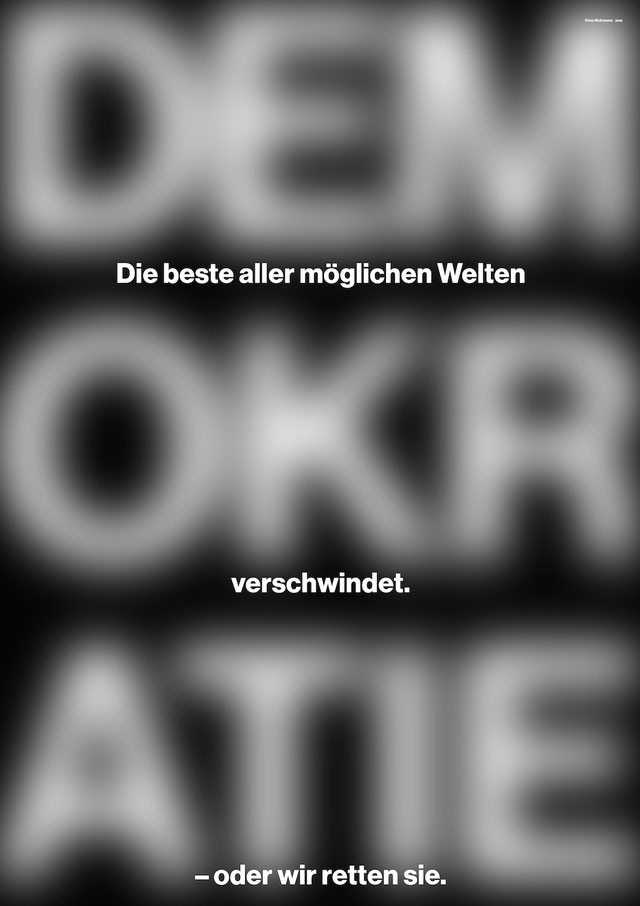

















Kommentar schreiben