
Tanz im August steht 2019 im Zeichen der Retrospektive der US-amerikanischen Choreografin Deborah Hay (1941), die während des Festivals auch selbst noch eines ihrer Stücke performt.

Deborah Hay war dreimal bei Tanz im August vertreten, mit If I Sing to You (2008), No Time to Fly (2012) und Figure a Sea (2016). Ihr grundlegendes Bekenntnis: "Tanz ist meine Form des politischen Aktivismus". Und das gilt für ihre Arbeit sowohl mit Laien als auch mit professionellen Tänzer*innen.
Mit The Match gelang ihr 2004 der ganz große internationale Durchbruch. Nach nunmehr 15 Jahren wagt sie sich an eine Neuinszenierung mit der dänischen Tanzcompagnie Cullberg, mit der sie eine mehrjährige erfolgreiche Praxis auch dank Auftragsarbeiten verbindet. Sie selbst sieht das so: „Mein Interesse und meine Begeisterung für die Arbeit mit Cullberg ist die kollektive Energie und Offenheit für das gemeinsame Tanzen. In der Kompanie arbeiten Tänzer*innen, die alle Grenzen von körperlicher Intelligenz und Bewegungsvirtuosität aufheben."
Das Werk selbst ist ein vielschichtiges personelles Quartett mit vier Soli, die spontan von der Person besetzt werden, die den jeweiligen Part zuerst als Solist*in übernehmen möchte. Das klappt reibungslos, wie sich auf der Bühne sowie im abschließenden Gespräch zwischen Choreografin und Tänzer*innen herausstellte. Und wenn nicht, dann müsse das eben im Tanz ausgetragen werden.

Cullbergs Tänzer*innen und Deborah Hay im Gespräch nach der Vorstellung
Jedes Solo folgt einem vorab festgelegten Thema und jeweils einem immer wieder neu auszutanzenden Verlauf, worauf sich die anderen dann einlassen – in einem raffinierten spontanen Zusammenspiel aller Kräfte in einem konkreten Moment. Das hat die Choreografin mit ihren Tänzer*innen gemeinsam herausgearbeitet, eine „Hundearbeit“, wie sie das selbst nennt.
„Ihr tiefes Verständnis“, schreibt Gabriel Smeets, künstlerischer Leiter von Cullberg, „für die Kernqualitäten des Tanzes (Körper, Raum, Zeit) entspringt einer lebenslangen Erfahrung sowohl als Tänzerin als auch als Choreografin.“
In der Vorstellung der Cullberg-Performance am Tag nach der Berliner Premiere ließ sich feststellen, wie großartig fließend sich die Tänzer*innen aufeinander einspielen bei der „Erschaffung eines Raumes für individuelle Erkundungen beim gemeinsamen Tanzen“ (G. Smeets). Beginnend mit der begeisternden Eingangssequenz von Adam Schütt, leichtfüßig, schwebend, tänzelnd, doch auch irgendwo animalisch.
The Match wurde bei der Uraufführung in New York als "eine faszinierende, lebendige Schlacht des Geistes" beschrieben. Die Neuinszenierung in Berlin zumindest könnte dem vielleicht – etwas weniger idealistisch – ein Lob der Dialektik von Geist und Körper hinzufügen. So jedenfalls erlebten wir´s.

Die Choreografin im Gespräch mit dem Publikum

Als „Family Friendly mit Selfie Session“ angekündigt, verwunderte nicht der bemerkenswerte Zulauf eines für Tanz im August- Festivals doch recht bemerkenswerten jungen Publikums. Das lag sicherlich nicht allein am knackigen Trailer des Body Concert der koreanischen Ambiguous Dance Company unter Leitung des Choreografen Boram Kim. Solchen Veranstaltungen eilt nicht zuletzt durch die Sozialen Medien ein sensationsheischender Ruf voraus.
Und das überhaupt nicht zu Unrecht. Es war auch für ältere Semester, die über einige choreografische Klischees hinwegsehen können, ein pures Vergnügen. Ein wahres Feuerwerk verschiedener Tanzstile mit atemberaubenden Tempi, Witz, Komik und Kabinettstückchen wie sie das Varietétheater kennt. Richtig verspricht das Programmheft „ein rauschendes Fest zu Musik von Barock bis Pop“, wobei, auch das stört nur Dogmatiker*innen, die Popmusik eindeutig im Vorteil lag.
Der Choreograf, selbst ein Jahrzehnt Background-Tänzer und nun einer der performenden Company, verficht natürlich eine eigene Philosophie für die Arbeit seiner ein Dutzend Jahre alten Truppe, nämlich dem Rhythmus der Dinge nachzuspüren und das Leben in diesem Sinne sich zu ertanzen. In zehn Kapiteln dieser mehr als einstündigen Schau, die in ihrer Rasanz nicht mehr zu toppen ist, wird dies auch immer wieder erfahrbar, selbst dort, wo die Erzählung sich eher trister Themen anzunehmen scheint.

Am Ende des poppigen Körperkonzerts wird als Zugabe nicht noch eins draufgesetzt – da wird es auf einmal leise, Ruhe kehrt ein, eine Art Rückbesinnung weg vom Mainstream des Pop hin zu asiatischer Tradition scheint hier Platz zu greifen. Durchaus eine finale Überraschung.


Auf ihrer Bühne schwarzer Sand und Licht, das die sieben Tänzer*innen, darunter auch die Choreografin, aus dem Nichts aufscheinen und je nachdem sie auch dorthin wieder verschwinden, besser verdämmern lässt. Und dann noch irgendwann leises Gezwitscher.
Ansonsten, nur in fleischfarbene, nicht unbedingt hautenge Leibchen gehüllt: die Leiber. Und um die geht es in WO CO, uraufgeführt 2016. Die direkte Übersetzung aus dem Japanischen würde nicht weiterführen, viel eher schon das, was die Choreografin selbst vorgibt: „WO CO spielt an einem fernen Ort, der uns nahe ist. Ein Nirgendwo, ein Jetzt der Vergangenheit und Wirklichkeit aller Menschen.“
Die auf den ersten Blick nackt wirkenden Frauen und Männer bewegen sich in einem sehr eigenartigen Rhythmus, der aus ihren Körpern stammen muss – da von außen keinerlei musikalische Einflüsse – aus der Dialektik der Körper, die auch mal animalisch anmuten können. Und das nicht nur, wenn sie im Sand sich winden oder sich zu einer Art Tausendfüßler formieren. Es ist ein Spiel von Bewegungen und Berührungen, die den Körper der anderen erkunden mit allen möglichen Körperpartien und -gliedern, wobei ganz auffallend die Handflächen nur selten eingesetzt werden. Dabei sind die Hände im Alltag die Hauptrezeptoren unseres Tastsinns.
Es ist ein Spiel mit Begehrlichkeiten und Sehnsüchten nach Anderen, nach einem Miteinander, jedoch auch der Zurückweisung. Das alles frei von Erotik, unterbunden schon durch die Einheitskleidung. Anderenfalls könnte die Gefahr bestehen die Empathie, die die begeisternde Körperakrobatik ausstrahlt, vielleicht nicht zu zerstören, doch mindestens zu stören. Denn die Nacktheit des performenden Personals könnte Vorstellungen von sehr soft praktiziertem Gruppensex aufkommen lassen.
Dagegen geht es ja auch im Tanz um Fiktion, hier um Lebensfreude stiftende Möglichkeiten taktiler Kommunikation, die uns im Alltag ja gar nicht so fremd ist. Und da muss auch nicht immer Haut auf Haut treffen, sondern eher auf die zweite Haut, gerade wenn es sich um körperliche Nähe handelt als Zeichen der Freundlichkeit.








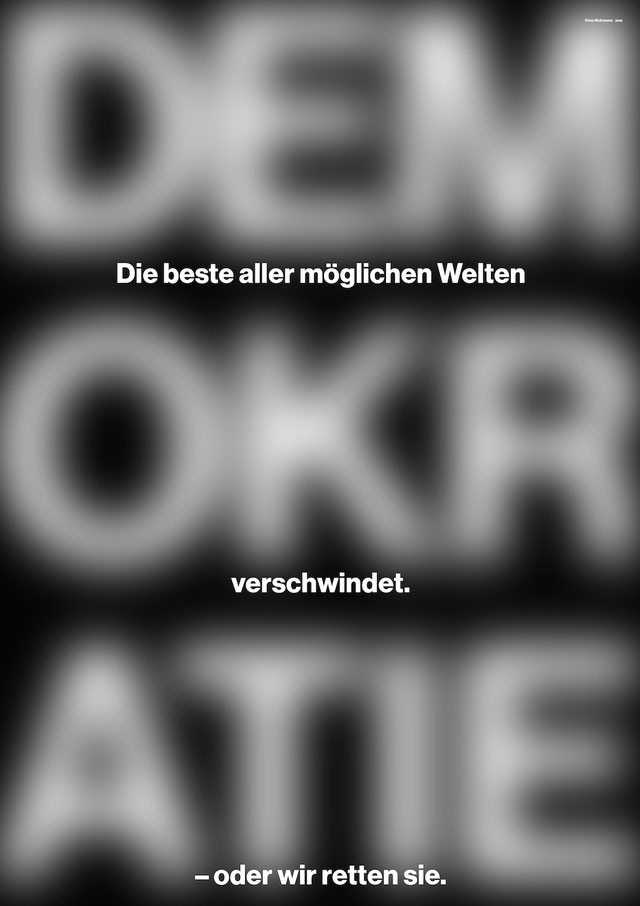


















Kommentar schreiben