HATE
von und mit Laetitia Dosch


Nachdenken über eine Nackte und ihren Hengst
Wenn sich das tragische Ende in der Schauspielnovelle von John Steinbeck bereits im Verlauf des Lesens abzeichnet, so setzt Laetitia Dosch in „HATE“ die Tragödie der Menschheit bereits als Ausgangspunkt für einen individuellen Lebensentwurf auf der Bühne zwischen Risiko und Freiheit.
Obwohl sie nach eigenen Worten „nur Versatzstücke der Wirklichkeit“ wahrnehmen und „das große Ganze nicht“ überblicken könne – eine höchst aufrichtige Aussage, die für die allermeisten gilt – , entwickelt sie einen fundamentalen „prinzipiellen, harten, kompromisslosen Blick“ auf den Zustand der Welt und ihre Unmenschlichkeit, „für den sich Beziehung auf Herrschaft reimt, deren Präsenz allgegenwärtig ist: in Beziehungen zu Tieren oder zu Migranten, in der Liebe oder in der Geopolitik“ (Mathieu Dochtermann).
Dosch sucht jedoch gegen jedes Verzweifeln im Freiraum des Theaters Antworten, ob nicht doch noch „Gleichberechtigung überhaupt möglich“ sei und fragt sich und uns: „Wie lassen sich ´gesündere´ Beziehungsformen erfinden, in denen niemand zu Schaden kommt oder unterdrückt wird?“ HATE solle „von unserem Verhältnis zum Anderen handeln?“
Ein durchaus mutiger Ansatz, der resignativem Schulterzucken die Stirn bietet und auf den ersten Blick geradezu emanzipatorisch wirkt. Dabei geht sie eigentlich gar nicht so provokant vor. Und es gibt nicht extrem viel, was man nicht schon mal gesehen und gehört hätte. Obwohl es schon provozieren kann, so unverblümt Sodomie oder vielleicht besser Zoophilie nicht nur verbal serviert zu bekommen, sondern auch gepaart mit Bereitschaft dazu und deutlich sprechender Gestik, verführerisch mit Karottenscheiben den zögerlichen Hengst anzulocken. Ob es dann irgendwann einmal zu nicht einvernehmlichen Sex gekommen ist, konnten wir in Hannover am zweiten Tag der HATE-Show nicht verifizieren. Bei der Freizügigkeit der ganzen Vorstellung läge das durchaus im Bereich des Möglichen.

Aber kommt es eigentlich darauf an?
Von juristischer Seite durchaus, denn an diesem Punkt könnte die Rechtsprechung der Kunst in einem öffentlichen Theater in die Quere kommen.
Von moralischer Seite insofern, als hier Fragen aufgeworfen werden, die, ginge es zum Beispiel nach vielen Hundebesitzer*innen, doch lieber im Privatbereich, in der Intimsphäre verbleiben wollen.
Und dann: nähme sich die Künstlerin hier nicht genau jene Freiheit, gegen die sie selbst so manifest opponiert, die, nur anders ausgedrückt, nun hieße, wiederum das Tier zu dominieren und dem „Herrschaftswillen der Spezies Mensch“ zu unterwerfen?!
Ohne das wissenschaftlich weiter führen zu wollen, es wurde auf der Bühne mehr als klar: Bei allem nackten und vielleicht für den einen oder anderen sogar verführerischem Werben der Performerin um ihren Hengst, dessen Penissprache war zumindest nicht auf derselben Wellenlänge. Und doch ist sie nicht nur Pferdeflüsterin, sondern riskiert die Gratwanderung aus dem Bereich der Kunst hinaus. Und auch der Ethik.
Doch zunächst mal: Laetitia Dosch spricht zum Pferd oder eigentlich zum Publikum, das sie wiederum zitiert. Oder besser gleich: sie spricht über uns: „Calais, Frauen, Einsamkeit, Ficken, Einfrieren der Eizellen in Spanien, französischer Rap, Migranten“. Und nicht nur an dieser Stelle sagt sie das, selbst nackt, als fleischgewordene nackte Wahrheit in ihrer ganzen Widersprüchlichkeit.

Leicht könnte man über all dem die ästhetische Seite vergessen. Angesprochen aber wurde sie schon: nämlich die Autorin als Kunstfigur und ihre spektakuläre Partnerwahl.
Alles beginnt für das Publikum mit dem Betreten des Theatersaals, vorher nachdrücklich ermahnt zu absoluter Stille und Ruhe in den Bewegungen. Auf der Bühne ein Schimmel.
Nichts Sensationelles, bekannt aus Zirkus und Streichelzoos, die wenigsten kennen´s aber auf dem Theater. Aber auch da ist es, wenn auch keine häufige, so eine durchaus geläufige Praxis. Mein eigenes erstes Theaterpferd habe ich als Schüler erlebt auf der Bühne der britischen Besatzungsmacht in Berlin bei einer Aufführung der Royal Shakespeare Company.
Nun hier in Hannover: das Pferd namens Corazon wartet schon, ungerührt und unbeweglich vor einer Waldlandschaft auf dem Vorhang hinten im Bühnenraum. Dieser Szenerie strahlt schlicht einen leichten Anflug von Erhabenheit aus, französische Kritiker scheuen nicht das Adjektiv: majestätisch. Allein dieser Moment ist es wert, gekommen zu sein.
Dann Auftritt der Autorin und Akteurin. Sie legt ihren Morgenmantel ab und geht nackt, nur mit einem Stoffgürtel bekleidet, langsam auf dasPferd zu, spricht mit ihm zunächst im Flüsterton, dank der sehr guten, leider etwas monotonen Simultanübersetzung übers Headset bestens verständlich. Tonlage und Lautstärke wechseln nun öfter. Hengst und Performerin kennen sich schon mindestens zwei Jahre lang. Er frisst ihr aus der Hand – immer wieder Möhrenscheiben. Sie sind gut eingespielt, ohne dass hier etwa schon Dressurverdacht aufkäme. Die Performerin erzählt permanent, auch davon, wie sie auf die Idee kam, mit einem Pferd auf der Bühne zu arbeiten.
"Und was erzählt ein Pferd über die Welt der Menschen?“ interviewt Hervé Pons die Performerin, die antwortet: „Das Pferd erzählt zuerst von der Schönheit der Natur“ und auch davon, wie Menschen mit Tieren umgehen, sie lieben, zum Fressen gern, sie einsperren und abschlachten. Pferdefleisch ist in anderen Gegenden eine Delikatesse.
Natürlich erzählen Tiere den Menschen etwas meist nur im (auf sie) übertragenen Sinne. Auch auf der Bühne bleibt es wesentlich eine Gestalt freundlicher, herzlicher Zuwendung von Liebe und Sexualität, da ja sonst für die nackte Frau, die keinesfalls wehrlos wirkt, keine Ansprechpartner*innen mehr auffindbar. Somit bleibt der Hengst Objekt menschlich warmer, weiblicher Zuneigung, wird allerdings nicht, wie Laetitia Dosch es einfordert „Akteur und Autor“. Zu keinem Zeitpunkt steht auch hier nicht die menschliche Definitionshoheit in Frage. Die angestrebte Gleichberechtigung kann es an diesem Punkt eben nicht geben, was nichts mit Speziesismus zu tun hat.
Was bleibt sind Pferd und Performerin, sie haben sich jahrelang eingespielt auf bestimmte Reaktionsmöglichkeiten, die beim Tier nie wirklich bis ins Letzte kalkulierbar sind. Wobei auch auf der Bühne eine Eingrenzung des Bewegungsspielraums des Pferdes durch einen fast unsichtbaren Draht gesichert ist, was natürlich die Kalkulierbarkeit erhöht. Dennoch stimmt natürlich auch, wie Thierry Fiorile betont, dass „je nach Stimmung des Pferdes“ jede Show anders wird.
Bis hierhin sind wir auch ganz sicher, uns auf dem Territorium der Kunst zu bewegen, denkt man nur an das famose Koyote-Video mit Joseph Beuys (https://vimeo.com/240418390). Der allerdings nicht verbal mit dem Tier kommuniziert. Dagegen kommen in der reinen Fiktion der Märchenerzählungen von La Fontaine, Perreault, der Grimm bis hin zum Kunstmärchen von Ludwig Tieck oder bei E.T.A.Hoffmann Tiere auch als selbständige Erzähler zu Wort mit der Gabe zum schriftlichen Ausdruck. Dass das Tier in menschlichen Idiomen spricht, ist schon lange Bestandtteil literarischer Erzählstrategien.
Genau hier kommt es bei HATE aber zum Stilbruch. Die reale Präsenz des Tieres und der ihm zugeordneten Menschengedanken und -stimme nach dem Bauchrednereffekt 2.0 führt durchaus zu einer gewissen Situationskomik, weil da Vieles zwischen Akteurin, Tier und Stimme spontan und auch durchaus humoristisch ausgehandelt wird. Doch der Gattungswechsel von dramatischer Theaterform – und wär´s eine Komödie! – zu zirzensischer Kleinkunst trägt allerdings mit zunehmender (und hier erheblich überzogener) Spieldauer immer weniger, führt zur Übersättigung und macht mehr als deutlich, dass so die eigenen explizit formulierten hohen Ansprüche der Autorin am Ende per Dressurstückchen und Humor, der nicht immer jeden lachen macht, verhackstückt werden. „Anthropomorphismus hat seine Grenzen“ (Mathieu Dochtermann).
Und das prägt leider das ganze Konzept und seine Realisierung:
Hass (von engl. hate) und Herz (von span. corazon) kommen nicht wirklich zum Zuge. Schade.

Fotografie: Dorothée Thébert Filliger








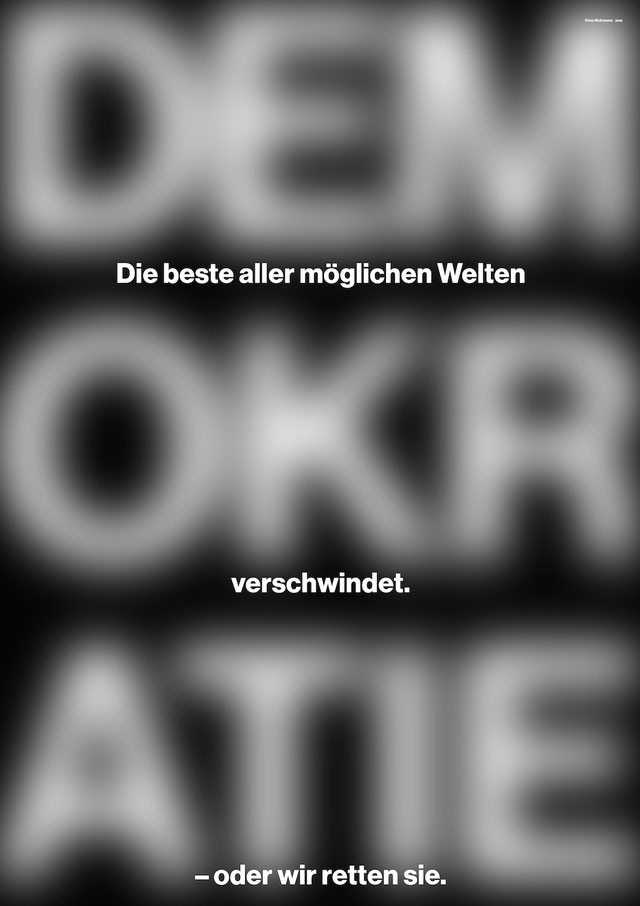





















Kommentar schreiben